
Der Mann der vielen Fähigkeiten
Herr Rohles, Sie bezeichnen sich selbst auf einem Ihrer Social-Media-Profile als Medienwissenschaftler, Blogger, Journalist, Musikfan, Fotograf und Webworker – und das in ständig wechselnder Reihenfolge. Was denn nun?
Gute Frage. Ich lebe im ständigen Wandel, aber im Grunde genommen glaube ich, dass alles, was ich mache, zusammengehört: Mein Beruf ist grundsätzlich Medienwissenschaftler, aber ich blogge auch immer mal wieder und gleichzeitig bin ich Designer und Fotograf. Ein roter Faden ist das Digitale: Onlinemedien haben früh meine Leidenschaft geweckt und im Studium habe ich mich sehr für das Web 2.0 interessiert.
Wie reagieren Arbeitgeber auf Ihre vielen verschiedenen Fähigkeiten? Fragen die nicht: Was können Sie eigentlich richtig?
Bei vielen meiner Jobs hieß es anfangs: „Ja, wir wollen dich haben, aber wir wissen nicht so richtig, was du machst – mach einfach mal!“. Meine Berufsbezeichnungen waren meist irgendwas mit
„Projektmanager“. Ich erinnere mich, dass ich damals zu meinem Chef scherzhaft gesagt habe: „Ich kann alles so ein bisschen und nichts richtig“. Letztendlich hat mich der Überblick, den ich in der Medienwissenschaft gelernt hatte, vorangebracht.
Begonnen hatten Sie ursprünglich mit einer Ausbildung zum Mediengestalter für Digital- und Printmedien und erst danach haben Sie Medienwissenschaft an der Uni Trier studiert. Wie kam es dazu, dass Sie sich für diesen Weg entschieden haben?
Eigentlich aus der Not heraus, weil ich ein relativ schlechtes Abitur hatte. Ich hätte fast sechs Jahre warten müssen, bis ich in den Studiengang reingekommen wäre. Zum Glück konnte ich damals ein Praktikum bei einer Werbeagentur machen, bei der ich anschließend auch meine Ausbildung begonnen habe. Im Jahr 2003 bin ich dann allerdings in den Studiengang Medienwissenschaft nachgerutscht, obwohl ich eigentlich noch fünf oder sechs Wartesemester vor mir hatte.
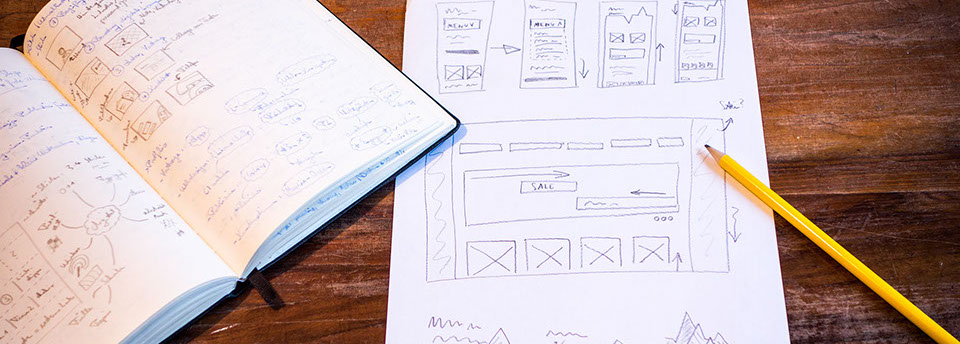
Woher kam Ihre Sicherheit und Ihr unbedingter Wille, Medienwissenschaft zu studieren? Sie haben für dieses Ziel schließlich viel aufgegeben.
Ich wusste: Das ist irgendwas mit Medien und in die Richtung will ich gehen. Ich hätte auch was mit Design studieren können.. Für mich war aber definitiv klar: Mediengestalter ist – so gerne ich das mache – immer derjenige, der Dinge ausführt. Ich wollte aber das Ganze aus einer übergreifenden Sicht sehen können. Deshalb habe ich mich für die Medienwissenschaft entschieden.
Wie haben Sie anschließend das Studium der Medienwissenschaft erlebt? Ist Ihnen etwas besonders in Erinnerung geblieben?
Es war sehr familiär, was mir gut gefallen hat. Ich kannte die Dozenten und meinen Jahrgang schnell und war mit allen vernetzt. In der Medienwissenschaft hatte ich einfach das Gefühl, dass es einen Austausch mit allen gab, was ich in meinen anderen Fächern nicht hatte.
Inhaltlich hat mich damals am meisten Steffen Büffel geprägt, der wissenschaftlicher Mitarbeiter war. Er wusste bereits in den Jahren 2003/2004, dass die digitale Welt alles verändern wird.
Gibt es etwas, was Ihnen ansonsten am Fach Medienwissenschaft besonders gut oder absolut nicht gefallen hat?
Insgesamt gab es viel Praxis in meinem Studium, was mir sehr gut gefallen hat. Natürlich war es aber auch so, dass ich nicht der Mainstream-Medienwissenschaftler war. Die meisten wollten damals in den Journalismus oder in Richtung PR gehen. Ich wusste noch nicht konkret, was ich künftig machen wollte und habe mir deshalb das, was ich gerade brauchte, selbst beigebracht. Wenn ich also Lust darauf hatte, habe ich einfach eine Website programmiert – auch wenn es dafür kein Uni-Angebot gab. Ein Studium heißt für mich nicht, dass du fertig bist, sondern dass du was angefangen hast.
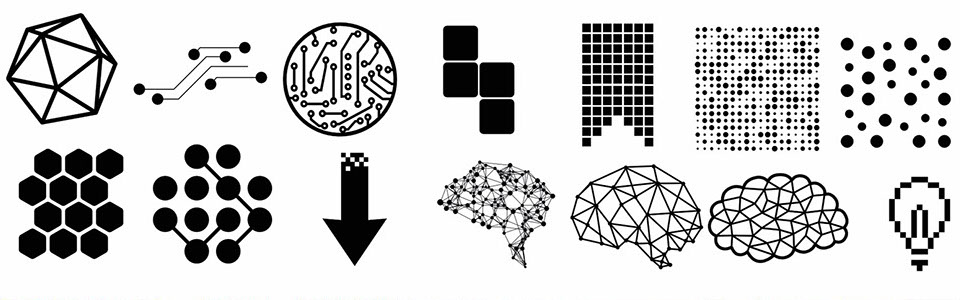
Wie ging es für Sie nach der Uni weiter?
Ich habe eine Stelle als Online-Redakteur bei ARTE in Straßburg angenommen. Nach Auslaufen der Stelle hatte ich die Möglichkeit, als Projektmanager in der Internetagentur Polybytes nach Trier zurückzukehren. Das war ein Sprung ins kalte Wasser: Ich musste Angebote schreiben, Kalkulationen machen und war für viel verantwortlich. Nach knapp zwei Jahren in der Internetagentur bin ich schließlich zu einer Stelle im Marketing bei alwitra, einer Firma, die Abdichtungen für Flachdächer herstellt, gewechselt. Meine Aufgabe war es, das Unternehmen digital voranzubringen. Ich habe mich dann neben dem Online-Marketing besonders mit digitalen Produkten und Plattformen beschäftigt.
Sie sind jetzt Doktorand an der Universität Luxemburg. War das geplant?
Nein, nicht direkt, obwohl ich immer den Kontakt zur Wissenschaft gehalten habe. Ich habe neben meiner Arbeit publiziert, Seminare gegeben und an einer
Promotion gearbeitet. Irgendwann kam mein jetziger Chef auf mich zu und hat mich auf eine Doktorandenstelle aufmerksam gemacht. Die Abteilung, in der ich arbeite, ist die Mensch-Computer-Interaktion. Ich mache ähnliche Dinge wie damals im Rezeptionslabor der Medienwissenschaft: Ich entwickle ein digitales Lern-Tool und evaluiere es anschließend bezüglich Usability und User Experience.
Was glauben Sie, welche Eigenschaften nötig waren, um es beruflich so weit zu schaffen?
Vielen Dank, Herr Rohles.